Zwischen Liebe und Verlust: Ein Blick zurück auf das Orpheus-Relief
Matilda Burger
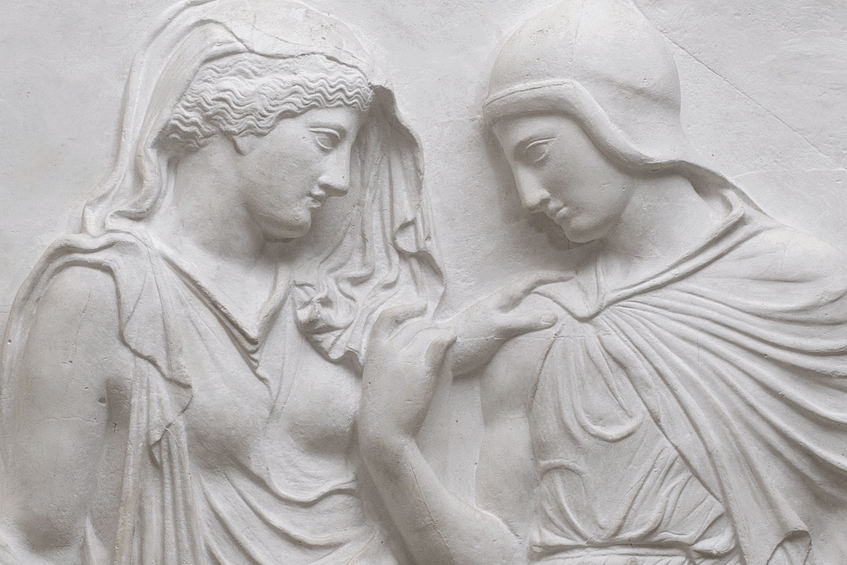
Foto: IKA, Kristina Klein
Dreifigurenrelief mit Orpheus und Eurydike
Rom, Villa Albani, Inv. 1031
kaiserzeitliche Kopie eines griechischen Originals aus dem letzten Viertel des 5. Jahrhunderts v. Chr.
Abguss: Wien, Archäologische Sammlung, Inv. 157; Erwerbung 1886
Orpheus und Eurydike
Der Orpheus-Mythos ist eine tragische Geschichte, die seit der Antike Kunst, Literatur und Musik inspiriert. Sie handelt von dem Sänger Orpheus, dessen geliebte Frau Eurydike stirbt, woraufhin Orpheus sich allein und nur mit seinem Musikinstrument in die Unterwelt begibt, um sie zurückzuholen. Die Unterweltgötter Hades und Persephone sind von seiner Bitte so gerührt, dass sie ihm dies gestatten, allerdings unter einer Bedingung: Orpheus darf sich auf dem Weg aus der Unterwelt zu seiner Frau, die hinter ihm geht, nicht umdrehen. Von Liebe und Verlangen erfüllt, tut er dies dennoch und verdammt Eurydike so dazu, in der Unterwelt zu bleiben – so zumindest die bis heute geläufigste Version des Mythos.
Unser Relief zeigt diese Geschichte. Es gehört zu einer Gruppe von insgesamt vier Reliefs, die sehr wahrscheinlich einst zusammengehörten und deren Originale um 420 v. Chr. vermutlich in Athen entstanden. Diese Originale sind verloren, allerdings sind von jedem Relief zwei, teilweise auch mehrere römische Wiederholungen bekannt. Unsere Reliefplatte zeigt drei Figuren (und da alle Reliefs dieser Gruppe drei Figuren zeigen, spricht die Forschung von den sogenannten attischen „Dreifigurenreliefs“): Die beiden Gestalten rechts sind Eurydike und Orpheus, links ist Hermes zu sehen. Auch wenn der Gott meist nicht explizit im Mythos vorkommt, geleitet er auf dem Relief Eurydike aus der Unterwelt. Hermes fungiert als Psychopompos, also als Seelengeleiter, der die Toten in die Unterwelt führt, und in dieser Aufgabe begleitet er hier Eurydike auch auf ihrem Rückweg. In der dargestellten Szene hat sich Orpheus gerade umgedreht und, indem er Hades’ Auflage missachtete, damit jenen tödlichen Fehler begangen, der seine Frau zur Rückkehr in die Unterwelt verdammt.
Orpheus hat sich gerade erst umgewandt, er ist noch immer bewegt. Sein Gewicht liegt auf dem rechten Fuß, während er mit seinem linken den Schritt zurück zu Eurydike noch vollendet. Trotzdem hat er aber bereits die Hand zu ihr erhoben, berührt ihr Handgelenk – nachdem er ihren Schleier aus dem Gesicht gestrichen hat – und sieht sie mit gesenktem Blick an. Seine rechte Hand ruht indessen bei seiner Leier, die ihn als Musiker kennzeichnet. Eurydike ist mit ebenfalls gesenktem Kopf zu ihrem Mann gedreht und berührt ihn sanft an der Schulter. Der Gott Hermes hält mit seiner linken Hand Eurydikes Rechte umschlossen und lehnt sich nach hinten, auch er befindet sich in einer Schrittposition. Er zieht sie behutsam weg von Orpheus, um sie zurück in die Unterwelt zu führen. Seine rechte Hand greift in sein Gewand und ihm hängt ein Hut, der zu den Attributen des Gottes gehört, über dem Rücken.
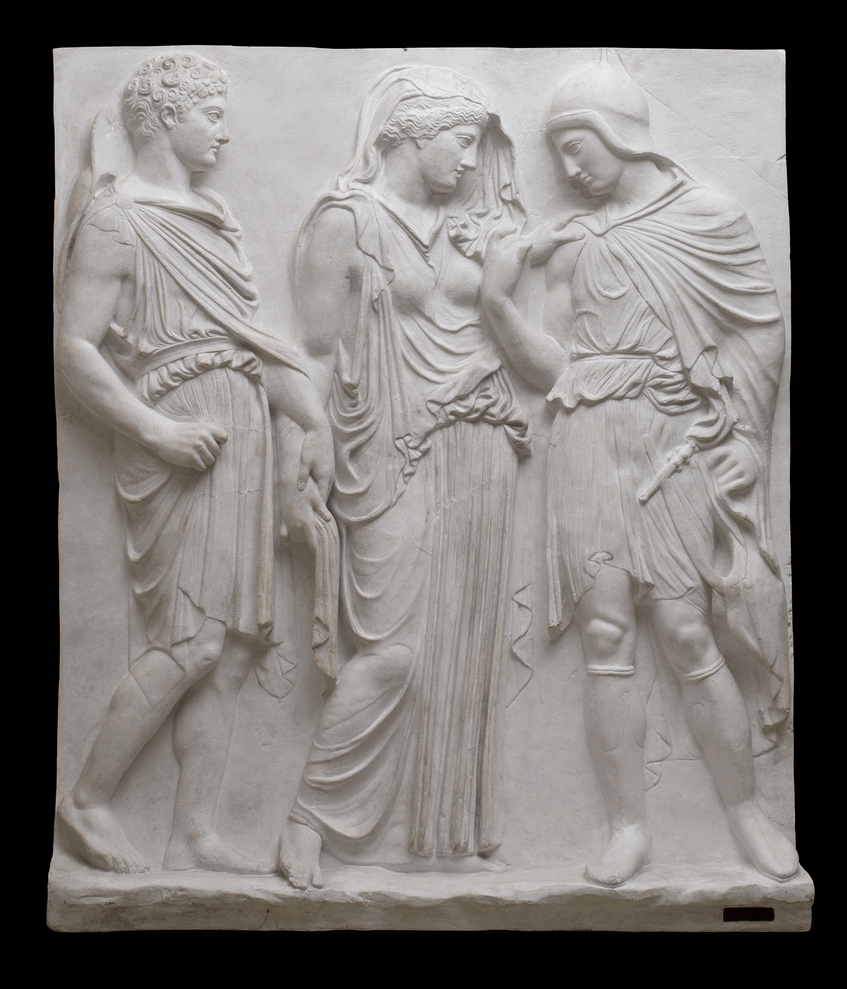
Foto: IKA, Kristina Klein
Abschied oder Hochzeit?
Welcher Moment genau dargestellt ist und ob das Relief tatsächlich das Scheitern der Mission des Orpheus ins Bild setzen sollte, ist in der Forschung seit Langem umstritten. Aus der griechischen Bildkunst und Literatur sind nämlich nur Zeugnisse einer geglückten Unterweltsfahrt überliefert. Die tragische Version des Mythos findet sich erst bei Vergil, der im 1. Jahrhundert v. Chr. schrieb. So könnte die Szene statt als Abschied auch als eine Art Hochzeit gesehen werden. Darauf könnte Orpheus’ Griff nach dem Schleier der Eurydike hindeuten, denn diese intime Geste begegnet in der griechischen Bildwelt vor allem bei Braut- und Eheleuten und veranschaulicht deren enge emotionale Verbindung. Das Relief zeigte dann Orpheus’ ersten Blick auf Eurydike als seine Frau, nicht seinen letzten. Auch das Berühren des Handgelenks ist eine Geste, die mit Hochzeiten assoziiert wird, und ebenso ist Hermes’ Anwesenheit bei Hochzeitsdarstellungen nicht unüblich. Das Relief könnte, selbst wenn der ungewollte Abschied dargestellt sein sollte, bildsprachlich solche Anklänge an Hochzeitsbilder zeigen, um die enge Verbindung zwischen Orpheus und Eurydike zu unterstreichen. Denn tatsächlich sind Hermes’ Gebärden eher ein Anzeichen dafür, dass er Eurydike zurückzieht, als dass er sie zu Orpheus bringt. Die Art, wie er ihren Arm hält, zeigt seine Rolle als Seelenbegleiter, der junge, unverheiratete Frauen in die Unterwelt führt, wie dies auch auf der steinernen Grab-Lekythos der Myrrhine (Museum of Classical Archaeology Databases) zu sehen ist, die oft mit dem Orpheus-Relief verglichen wird. Auch Hermes’ Schrittstellung deutet auf die Rückkehr in das Totenreich hin.
Durch seinen zurückgelehnten Oberkörper schafft Hermes jedenfalls einen physischen Abstand zwischen sich selbst und den beiden Liebenden. Orpheus und Eurydike werden so zu einer Einheit, in die Hermes nicht eindringen kann. Mit ihren gesenkten Köpfen und ihrer Beinstellung stehen sie sich spiegelverkehrt gegenüber. Auch die Überkreuzung ihrer Hände soll das Innenleben und die tiefe Verbundenheit der Figuren mit visuellen Mitteln zeigen. Orpheus dreht sich nicht nur um, er hebt auch Eurydikes Schleier, um ihr Gesicht zu sehen, und Eurydike berührt mit einer liebevollen Geste seine bloße Schulter und sucht seinen Blick. Die beiden haben etwas Sanftes und Melancholisches an sich, was im Kontrast zu anderen Bildwerken aus dem klassischen Griechenland steht. Das Bildwerk hält also – gegebenenfalls selbst im Augenblick des Abschieds – einen innigen Ausdruck der Verbindung zwischen den beiden Figuren fest.
Zeitlosigkeit
Dargestellt auf dem Relief ist der Höhepunkt des Mythos. Die Ausgangssituation wird als Hintergrundwissen vorausgesetzt: die Hochzeit von Orpheus und Eurydike, ihr Tod, Orpheus’ Reise in die Unterwelt und Hades’ Bedingung. Der Fortgang der Erzählung wird lediglich angedeutet, dennoch kann die Szene als Veranschaulichung des kompletten Mythos verstanden werden, da sie den zentralen Moment zeigt. Die Darstellung wird aus der Zeit herausgelöst und der Augenblick eingefroren, obwohl er eigentlich flüchtig ist. Das Medium des Reliefs erlaubt es besonders gut, die Zeit sowohl für Betrachtende als auch für die Charaktere zu versteinern. Wie lang war dieser Moment wohl für Orpheus, bis er sich seines Fehlers bewusst wurde? Wie lange standen er und Eurydike sich gegenüber, bevor sie in die Unterwelt zurückkehren musste? Auch der Betrachtende sieht immer nur den Augenblick kurz vor der Katastrophe, aber es kommt nie so weit. Eurydike befindet sich somit in einem Zustand zwischen Leben und Tod, genauso aus der Zeit herausgerissen wie die gesamte Darstellung.
Weiterführende Literatur
- St. Böhm, Die Dreifigurenreliefs und ihre klassischen Originale. Das Peliadenrelief als Beispiel für die Suche nach einem Phantom, JdI 132, 2017, 187–223.
- H. Götze, Die attischen Dreifigurenreliefs, RM 53, 1938, 189–280.
- K. Junker, Die attischen Dreifigurenreliefs, in: K. Stemmer (Hrsg.), Standorte. Kontext und Funktion antiker Skulptur. Ausstellungskatalog Berlin (Berlin 1995) 293–298.
- M. O. Lee, Mystic Orpheus. Another Note on the Three-Figure Reliefs, Hesperia 33, 4, 1964, 401–404.
- V. Macek, Das Prinzip Eurydike. Rezeptionen des Orpheusmythos in Literatur und Kunst (Wien 2019).
- E. Michailidou, The Lekythos of Myrrhine. Funerary and Honorific Commemoration of Priestesses in Ancient Athens, Hesperia 89, 3, 551–579.
- P. E. Nulton, The Three-Figured Reliefs: Copies or Neo-Attic Creations?, in: D. B. Counts – A. S. Tuck (Hrsg.), Koine. Mediterranean Studies in Honor of R. Ross Holloway (Oxford 2009) 30–34.
- W. H. Schuchhardt, Das Orpheus-Relief, Werkmonographien zur bildenden Kunst 102 (Stuttgart 1964).
